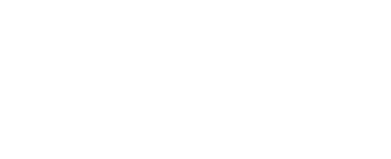En Theater met Hätz un Siel
Nach Winters Tod im Jahre 1862 entbrannte ein heftiger Streit um die rechtmäßige Nachfolge. Ein Gezänk mit gutem Ausgang: Peter Josef Klotz, verheiratet mit einer Enkelin Winters, führte das Theater weiter; nach seinem Tod übernahm dessen Witwe das Zepter.
1919 dann verstarb auch das letzte Mitglied der engagierten Puppenspielerfamilie. Zwar versuchten der Heimatverein Alt Köln und der Kölnische Geschichtsverein diese einmalige Institution zu retten – doch erst im Jahr 1925 gründetet sich eine Kommission zur Wiederbelebung der Kölner Puppenspiele. Ein Segen für das Hänneschen und seine Fans: Als Puppenspiele der Stadt Köln konnte das Theater am 9. Oktober 1926 wieder eröffnen. 12 Jahre später zog die Bühne dann erstmals an den Eisenmarkt und sorgte mit einem historischen Umzug für reichlich Spektakel ...